Nein, die PISA-Tests sind nicht egal
Österreich und Deutschland sollten ihr notorisches Versagen bei den PISA-Tests ernst nehmen: Wenn Schüler an den Tests scheitern, scheitert der zukünftige Wohlstand aller.
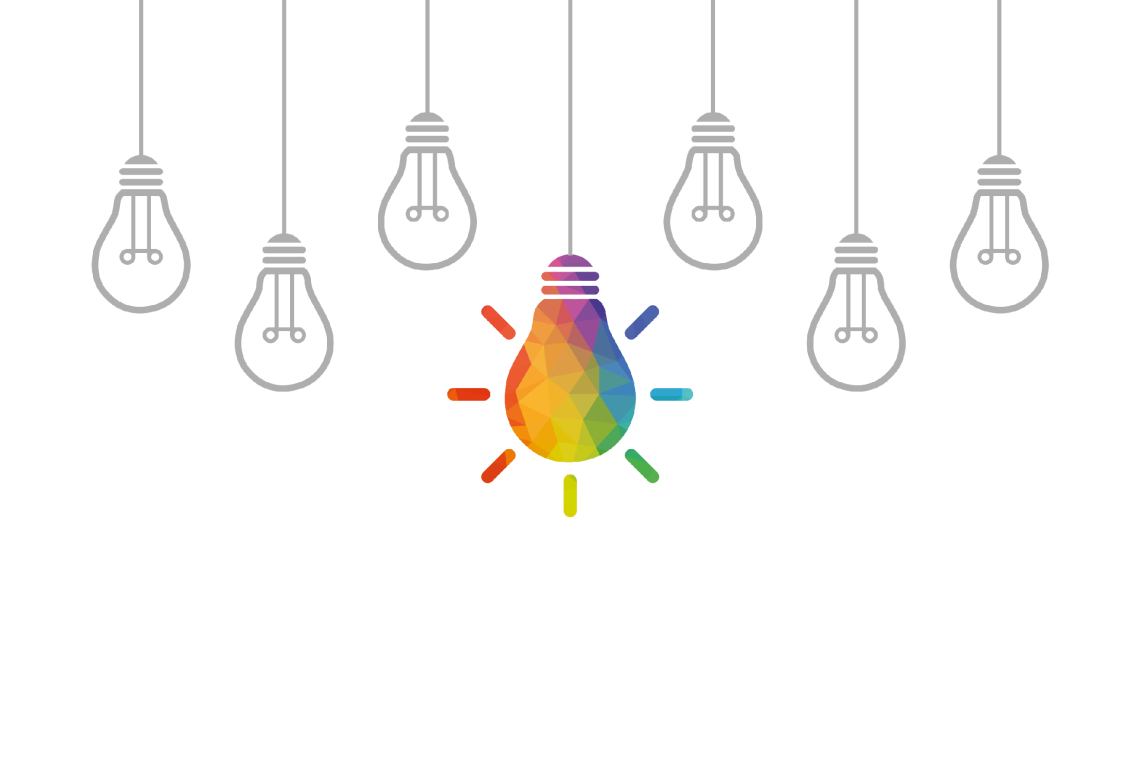
Auf den Punkt gebracht
- Böses Erwachen. Das schwache Abschneiden bei der ersten PISA-Bildungsstudie 2000 hat Österreich und Deutschland geschockt. Man wähnte sich an der Weltspitze.
- Erfolgsindikator. Zwar gibt es berechtigte Kritik an den PISA-Tests. Doch im globalen Vergleich sind Bildungsleistungen einer der besten Wohlstandsindikatoren.
- Geld-Illusion. Höhere Bildungsausgaben stehen dabei in keinem direkten Zusammenhang mit Schülerleistungen. Mittel müssen gezielt eingesetzt werden.
- Reformbedarf. Kleinere Klassen bringen nicht automatisch Erfolge, Investitionen in die Lehrerausbildung schon. Und: die Schüler sollten erst später getrennt werden.
Das kennt fast jeder aus seiner Schulzeit: Das Gefühl, unfair benotet worden zu sein. Oder man erinnert sich noch, dass die Aufgaben bei einer bestimmten Matheschularbeit kniffliger waren als sonst. Den gleichen Deutsch-Aufsatz hat ein Lehrer vielleicht mit einem Sehr gut bewertet, eine andere Lehrerin mit einem Befriedigend. Wohl oder übel akzeptiert man, dass im Schulsystem eine gewisse Willkür bei der Beurteilung mit hineinspielt. All das macht es schwierig, die Leistung von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Schulen objektiv zu messen, geschweige denn unser Schulsystem als Ganzes zu bewerten.
Mehr im Dossier Schule
- Der Pragmaticus: Die Neuerfindung der Schule
- Andreas Salcher: Was Schüler wirklich lernen sollten
- Podcast: Was gute Schulen können
- Interview mit Yasemin Karakaşoğlu: Schule heute: Keine Chance ohne Deutsch
- Isabell Welpe: Fünf Schulen, fünf Innovationen
- Matthias Strolz: Befreien wir die Schulen!
Das änderte sich im Jahr 2000, als mit der PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) erstmals ein umfassender und für die breite Öffentlichkeit sichtbarer Ländervergleich der Bildungsleistungen durchgeführt wurde. Der Schock in Staaten wie Deutschland und Österreich war groß: Kam die Studie doch zu dem Schluss, dass die Schulkinder hierzulande weit weg von der Weltspitze sind. Wie kann das sein?
Von ihren Kritikern wird die PISA-Studie gerne abgetan: Erstens sei sie ein schlechter Maßstab für ein effektives Schulsystem. Und zweitens solle man die Ergebnisse nicht überbewerten. Darum ist es wichtig zu verstehen, was überhaupt gemessen wird. Und wie Forscher daraus sinnvolle Lehren ziehen können.
Kompetenzcheck statt Wissensabfrage
Derzeit läuft die achte PISA-Welle, deren Auswertung für 2023 erwartet wird. Alle drei Jahre werden mit standardisierten Aufgaben die Grundkompetenzen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen von 15- bis 16-Jährigen aus inzwischen über 70 Ländern verglichen. Dass dabei regelmäßig einige Staaten Ostasiens – wie Singapur, Japan, Südkorea oder einige chinesische Provinzen – im Spitzenfeld liegen, führt manchmal zu dem Vorurteil, dass bei solchen standardisierten Tests lediglich mit Drill auswendig gelernte Inhalte abgefragt werden. Doch das stimmt nicht: Die teilnehmenden Schulkinder müssen bei PISA ihr Wissen anwenden können, um Probleme zu lösen.
Ostasiatische Schüler übertrumpfen europäische besonders bei Aufgaben, die Kreativität erfordern.
Ein typisches Beispiel wäre, ein Diagramm zu interpretieren, das die Geschwindigkeiten eines Rennautos auf einer Rennstrecke abbildet. Mal gibt der Pilot Gas, dann bremst er in den Kurven ab, entsprechend steigt und fällt die Kurve im Zeit-Weg-Diagramm. Die Schülerinnen und Schüler müssen dann die richtige Rennstrecke aus einer Auswahl identifizieren. Das erfordert Grundkenntnisse über Geschwindigkeitsmessung und deren grafische Darstellung sowie die Fähigkeit, dieses Wissen auf eine praktische Situation zu übertragen. Tatsächlich ist es so, dass die ostasiatischen Schüler viele ihrer europäischen Altersgenossen besonders bei Aufgaben übertrumpfen, die Kreativität erfordern und die über reines Auswendiglernen hinausgehen.
Robustes Fundamt schaffen
Aber wie lassen sich aus einer großen Vergleichsstudie sinnvolle Maßnahmen für die Bildungspolitik ableiten? Schließlich hängen schulische Leistungen nicht nur vom Schulsystem ab, sondern auch von kulturellen Einflüssen und besonders stark vom familiären Umfeld. Auch die Herkunft spielt eine Rolle: Kommen die Kinder aus sozial sehr unterschiedlichen Familien? Wie hoch ist der Anteil von Kindern, deren Muttersprache von der Unterrichtssprache abweicht? Und so weiter.
Schule heute: Keine Chance ohne Deutsch
Die Herausforderung für Wissenschaftler besteht darin, verschiedene Merkmale eines Schulsystems trotz dieser sozialen und kulturellen Einflüsse isoliert zu bewerten. Das ist möglich. Man muss sich in Europa nicht unbedingt an asiatischen Systemen orientieren, schließlich schneiden Länder wie Estland, Finnland oder Kanada ebenfalls hervorragend ab. Außerdem findet in diesem Jahr bereits die achte PISA-Testreihe statt. Somit lassen sich Entwicklungen in einzelnen Ländern beurteilen, die bestimmte Reformen durchgeführt oder unterlassen haben. Außerdem ermöglicht es die große Fülle an Daten, einzelne Effekte statistisch zu isolieren. Die folgenden Ergebnisse beruhen somit auf einem robusten Fundament.
Ernüchternde Erkenntnis
Internationale Bildungsvergleiche, von denen PISA der größte, aber nicht der einzige ist, haben eine ernüchternde Erkenntnis gebracht: Mehr Geld in das Schulsystem zu stecken, hat nicht viel bewirkt. Allein der Vergleich europäischer Länder zeigt keinerlei Zusammenhang zwischen den Ausgaben pro Schüler und den PISA-Leistungen. Das bestätigt sich bei einer der kostspieligsten Maßnahmen, die vielfach von der Politik eingefordert wird: mehr Lehrkräfte einzustellen und die Schülerzahl pro Klasse zu verkleinern.
Zahlen & Fakten
Personalkosten machen in den meisten Ländern zwischen 70 und 80 Prozent der gesamten Bildungsausgaben aus. Jedoch führten kleinere Klassen nicht zu besseren Schülerleistungen. Natürlich hängt das damit zusammen, wie der Unterricht gestaltet wird. Wenn Lehrkräfte vor 15 Schülerinnen und Schülern das gleiche machen wie vor 25, bringt das wenig. Wichtiger ist, dass die vorhandenen Mittel effektiv eingesetzt werden. Die PISA-Studien zeigen, wie es besser ginge.
Wirksame Maßnahmen
- Standardisiertes Testen: Beim ersten PISA-Schock zeigte sich in Deutschland eine Trennlinie zwischen Bundesländern mit und ohne zentralen Abschlussprüfungen. Länder, die mit standardisierten Prüfungen vergleichen, was die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, erzielten erheblich bessere Ergebnisse. Einheitliche Tests in einem Schulsystem erlauben es Schülern, Lehrern, Direktoren, Eltern sowie der Administration ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu identifizieren. Das wirkt als Anreiz, sich zu verbessern. Voraussetzung für den positiven Effekt ist eine gewisse Transparenz bei den Ergebnissen. Außerdem ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Ergebnisse wichtig – dass einzelne Schulen mit lauter Kindern aus Akademikerfamilien bei Tests besser abschneiden, sagt noch nichts über die Qualität des Unterrichts aus.
Wenn Lehrkräfte vor 15 Schülerinnen und Schülern das gleiche machen wie vor 25, bringt das wenig.
- Schulautonomie: Schulen mehr Freiräume zu lassen, erhöht die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Vor allem in Kombination mit standardisierten Tests können autonome Einrichtungen auf Schwächen gezielt reagieren. Das bedeutet etwa, sich Lehrkräfte aussuchen zu können, den Unterricht frei zu gestalten und über das Budget selbst zu entscheiden. In Deutschland werden die meisten Lehrkräfte von Bildungsbehörden bestellt – nach dem Prinzip der Zentralverwaltungswirtschaft. Das ist ein erstaunlicher Anachronismus, den man in keinem anderen Bereich der Gesellschaft so antrifft.
- Freie Trägerschaft: Mehr Wettbewerb zwischen Schulen fördert die Qualität – das zeigen zahlreiche Untersuchungen. Zum Beispiel in den Niederlanden. Dort gibt es ein System freier Trägerschaft: Jeder hat das Recht, eine Schule zu gründen und erhält dafür öffentliche Mittel für jeden eingeschriebenen Schüler. Es geht also wohlgemerkt um die Trägerschaft, nicht um die Finanzierung, die einen freien Zugang für alle Familien sicherstellen sollte. Drei Viertel der niederländischen Kinder besuchen solche privat organisierten Schulen. Wichtig ist dabei, die Leistungen in allen Schulen mit standardisierten Tests zu überprüfen und behördlich sicherzustellen, dass in Schulen mit freier Trägerschaft keine Inhalte gelehrt werden, die gesellschaftliche Grundsätze missachten.
- Frühe Aufteilung vermeiden: Eine weitere Lektion aus PISA und anderen Bildungsvergleichen sind die Nachteile von mehrgliedrigen Schulsystemen für die Chancengleichheit. Teilt man Kinder bereits nach der vierten Klasse – in einem Alter, in dem sie noch keine mündigen Entscheidungen treffen dürfen – auf verschiedene Schulformen auf, verfestigt man soziale Unterschiede. Vor allem begabte Kinder aus bildungsfernen Familien können ihr Potenzial nicht entfalten, weil ihnen zuhause sowie in der Schule die richtige Förderung fehlt. Umgekehrt hat sich gezeigt, dass eine spätere Aufteilung keine negativen Effekte auf die Schülerleistungen insgesamt hatte. Die meisten Länder haben die frühe Aufteilung längst abgeschafft. Mit ihrer Praxis, Kinder bereits nach der Volksschule entweder in Richtung Akademikerlaufbahn oder in Richtung niedrigere Abschlüsse aufzuteilen, stehen Deutschland und Österreich weltweit ziemlich allein da.
Es hat sich gezeigt, dass eine spätere Aufteilung keine negativen Effekte auf die Schülerleistungen hatte.
- Mentoring: Man braucht nicht immer internationale Bildungsstudien, um wirksame Maßnahmen zu erkennen. Da gibt es etwa mehrere neue Studien zu Mentoring-Programmen. Benachteiligten Kindern und Jugendlichen fehlt die familiäre Unterstützung, um in der Schule erfolgreich zu sein. Sie werden allzu schnell als hoffnungslose Fälle abgestempelt. In einem Feldexperiment haben wir beim Ifo-Institut in München Studierende begleitet, die als freiwillige Mentorinnen und Mentoren in Problemschulen gehen. In Eins-zu-Eins-Beziehungen lernten die Mentoren und die Jugendlichen einander kennen und redeten über ihre Zukunftspläne – was die Jugendlichen beruflich machen wollten, welche Leistungen man dafür bringen müsse, wo man sich bewerben könnte und so weiter. Über drei Jahre haben wir Jugendliche mit Mentor mit solchen ohne Ansprechpartner verglichen. Bei sozial Bessergestellten sah man keine zusätzlichen positiven Effekte, bei Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen jedoch konnten die Arbeitsmarktaussichten durch das Mentoring erheblich gesteigert werden.
Bildung schafft Wohlstand
Warum es für eine Gesellschaft essenziell ist, die allgemeinen Bildungsleistungen zu steigern, zeigt ein Blick in die jüngere Geschichte. Länder wie Singapur, Südkorea oder Taiwan zählten in den 1960er Jahren zu den Entwicklungsländern. Ihre Wirtschaftsleistung und der Lebensstandard lagen weit unter dem Niveau der Staaten Südamerikas. Heute ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Südkorea mehr als viermal so hoch wie jenes Brasiliens. Wie haben die sogenannten Tiger-Staaten Asiens das geschafft?
Vor allem durch ihr effektives Bildungssystem. Die Bildungsjahre in beiden Weltregionen waren ähnlich, die Lücke klafft in den Leistungen bei Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Insgesamt erklärt dieses höhere Wissenskapital zu mehr als drei Viertel den Unterschied in den langfristigen ökonomischen Wachstumsraten der Nationen, wie einschlägige Untersuchungen zeigen.
Wie stark Bildung sich lohnt, lässt sich auch für den einzelnen Bürger berechnen. Die PIAAC-Studie ist quasi ein PISA für Erwachsene. Sie misst erworbene Kompetenzen in fünf Stufen. Mit jeder höheren Stufe liegt das Einkommen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ein Viertel höher. Darum sollte es uns nicht egal sein, wie wir bei den PISA-Studien abschneiden. Internationale Vergleiche ermöglichen es, über den Tellerrand zu schauen und von anderen zu lernen. Schließlich geht es um unseren zukünftigen Wohlstand und mehr Chancengleichheit.
Conclusio
Die Schulsysteme im deutschsprachigen Raum schneiden im internationalen Vergleich enttäuschend ab. Dabei steht für die Gesellschaft viel auf dem Spiel: der Wohlstand einer Nation ist zu drei Vierteln mit dem Wissenskapital ihrer Bürger und Bürgerinnen zu erklären. Erfolg hat dabei nicht, wer mehr Geld ins System steckt, sondern wer neue Ideen ausprobiert. Schulautonomie, freie Trägerschaft und zentralisierte Prüfungen haben sich international bewährt. Um die Chancengleichheit zu verbessern, sollten Kinder nicht zu früh auf unterschiedliche Schultypen aufgeteilt werden. Außerdem sind relativ günstige Maßnahmen wie Mentoring-Programme effektiv, um Schülern aus bildungsfernen Familienhäusern eine Potenzialentfaltung zu ermöglichen und damit ihre Arbeitsmarktaussichten zu verbessern.
