Plädoyer für mehr Höflichkeit
Die Schatten der vielen Krisen – von Krieg bis Klimawandel – führen zu einer Verrohung im Alltag. Besonders deutlich wird das im Umgang der Menschen miteinander in sozialen Medien und per E-Mail. Höflichkeit schützt uns voreinander und vor uns selbst.
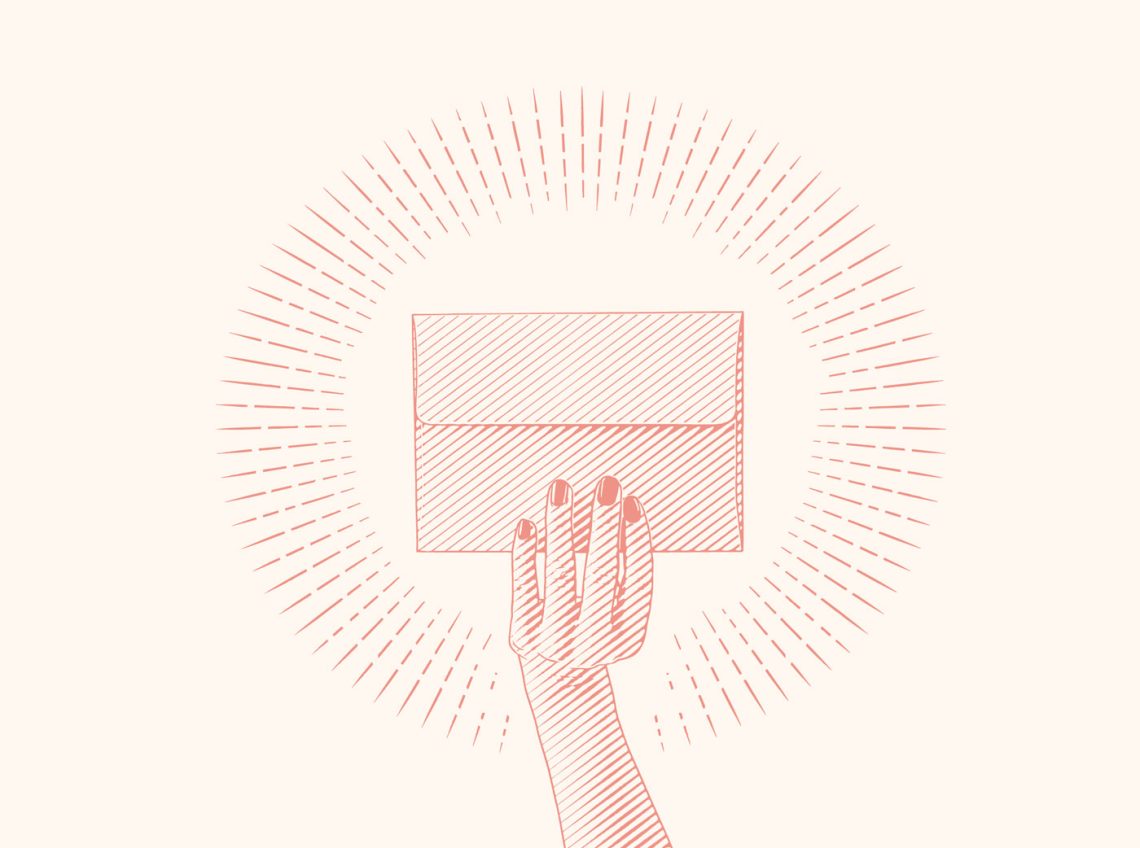
Der Krieg dauert. Viel länger, als ich gedacht habe, entsetzlich lange. Und zugleich stumpft man ab, die Problemchen des frühen Sommers belegen einen mit Beschlag – darf man Sprühsonnencreme nehmen, geht die alte Fliegersonnenbrille noch?
Ich leide an diesen Widersprüchen. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, dass gerade so viele Menschen fliehen müssen, hungern, ertrinken, während ich mir über den richtigen Sonnenhut Gedanken mache. Wobei: In diesem Jahr habe ich mich für ein fesches Cap entschieden, falls es jemanden interessiert.
Ich leide an der Scham, aber ich bin ihrer auch überdrüssig, und langsam beschleicht mich der Gedanke, dass sie falsch ist. Wollen nicht alle Menschen über solche süßen Nichtigkeiten nachdenken, wollen wir nicht alle mit unseren Lieben in der Sonne sitzen, Eis schlecken und über unsere Familie reden, über ein gutes Buch oder eine schlechte Serie, über unsere Vorsätze, unser Scheitern, unsere Sommerfrisur?
Die verdammte Barbarei schmerzt
Das Schwererträgliche ist ja nicht, dass wir wenigen das können – sondern dass so viele von uns es nicht können. Dafür, dass sich das ändert, gilt es zu kämpfen, das sind der Frieden und die Gerechtigkeit, deren Mangel hineinschmerzt in meine privilegierten Sommertage. Und die verdammte Barbarei. Die schmerzt auch. Als wäre alles immer roher geworden, gröber, als würden alle guten Geister uns verlassen: die Höflichkeit, der Anstand, das Zartgefühl.
Macht uns das Internet unhöflich, oder machen wir das Internet unhöflich?
Der Krieg ist ja stets der Endpunkt solcher Entwicklungen; in ihm zeigt die Menschheit ihre hässlichste Fratze – eine, die es einem manchmal schwer macht, kleinen Kindern in Sommerkleidern zuzulächeln, weil die ja auch erwachsen werden. Sie werden Menschen wie wir – solche, die zu so etwas fähig sind, wobei unsere Kriege in Deutschland und Österreich schon etwas zurückliegen, aber allzu lange eben nicht.
Verlieren wir in der digitalen Welt die Fasson?
An diese Dinge denke ich, während mein ganz normales Leben ganz normal weitergeht. Noch, denke ich, noch. Denn der Ausnahmezustand wird lauter, dringlicher. Ich traue mich schon gar nicht mehr, an das Klima zu denken, nur an den brennenden Amazonas denke ich ab und zu, und dann möchte ich weinen.
Aber, wie gesagt: Das Leben geht ja einfach weiter, die E-Mails, die Arbeit, das Internet, aber auch dort finden sich natürlich die Schatten der Krisen unserer Tage und – das ist mir schon länger aufgefallen – der Verrohung. Ich finde, die Leute werden online immer gröber.
Ist Ihnen das auch aufgefallen? Macht uns das Internet unhöflich, oder machen wir das Internet unhöflich? Ist das nur eine Reaktion auf eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, oder tragen die Anonymität, aber auch die inhärente Beschleunigung des Digitalen dazu bei, dass wir vollends die Fasson verlieren?
Hass im toten Winkel
Denn, lassen Sie mich darauf zurückkommen: Wenn es letztlich wirklich darum geht, dass es sich dafür zu kämpfen lohnt, dass wir alle mit lieben Menschen, mit alten und jungen, mit Kleinfamilienversuchern und Nichtbinären und solchen, die auf der Suche sind, an einem Sommertag an einem Tisch sitzen und miteinander plaudern können, über Nichtiges und Gewichtiges, dann sind liebenswürdige Umgangsformen und existenzielles Taktgefühl unverzichtbar. Sie sind auch sonst unverzichtbar, weil wir Menschen alle komische Gesellen sind, empfindlich und „aus krummem Holz geschnitzt“, wie Immanuel Kant notierte.
Die Höflichkeit schützt uns – vor uns selbst und voreinander, weil der Mensch ein Wesen ist, das sich nicht sich selbst überlassen darf. In jedem von uns ist das Ganze – Güte und Gier, Großmut und Geiz, und wer sich keine Regeln gibt, lässt oft genug die dunklen Kräfte gewinnen.
Das lässt sich auch im Internet beobachten. Ich meine jetzt nicht nur die Shitstorms, die uns heimsuchen wie biblische Plagen, noch die irren Paralleluniversen der coronaleugnenden Neonazis und Putinversteher, sondern auch die ganz normale Kommunikation, der wir alle ausgesetzt sind.
Schweigen ist effizient, aber unhöflich
Vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, dass es vor allem in der beruflichen Kommunikation eine Art Paradigmenwechsel gegeben hat, den ich mir so vorstelle: Okay, wir werden diese Emojis nicht mehr los, und wir erlauben auch in Business-E-Mails ab und zu einen Smiley, dafür verzichten wir aber fortan bei allen E-Mails auf die letzte Schleife, also auf Dank und Bestätigung.
Am Anderen zu sparen heißt, Beziehungen auf ihren Nutzen zu reduzieren.
Lassen Sie mich das an zwei Beispielen konkretisieren: Ich bestätige meinem Gegenüber einen Terminvorschlag. Früher: Danke, freu mich, bis dann. Heute: Schweigen, Termin steht aber. Oder: Ich schicke etwas an jemanden. Früher: Danke, ist angekommen. Heute: Schweigen, wurde aber empfangen.
Dieses Schweigen ist ungemein effizient, es reduziert die E-Mail-Flut, an der wir alle leiden, aber es ist nicht höflich, im Gegenteil. Am Anderen zu sparen heißt, Beziehungen auf ihren Nutzen zu reduzieren. Und wenn man immer weiter spart, schreibt man irgendwann nur noch LG oder HG, die Kürzel von „liebe Grüße“ oder „herzliche Grüße“, was so ungefähr das Liebloseste ist, was ich mir am Ende einer E-Mail vorstellen kann.
Zeit für herzliche Grüße
Überhaupt das Ende. Auch hier werden Beziehungen empfunden, und auch hier lohnt es sich, über eine rücksichtsvollere Welt nachzudenken. Man denke nur an die Unsitte der changierenden Abrede. Manchmal sitze ich vor einem hingeworfenen „viele Grüße“ und grüble, was aus dem „herzlich“ der letzten E-Mail wurde – und ob das etwas mit mir zu tun hat. Hat es wahrscheinlich nicht – aber man kann nie wissen.
Ode an eine kaputte Welt
Um diesen immer auch bedrückenden Ungewissheiten vorzubeugen, habe ich selbst irgendwann beschlossen, im beruflichen Kontext einfach immer „herzliche Grüße“ zu schreiben. Was das Zeit spart, mir selbst und meinem Gegenüber. Und gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir alle darum kämpfen müssen, an den Menschen zu glauben, an uns zu glauben, sind solche kleinen Akte gegenseitiger Anteilnahme wertvoller, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn die Welt, von der wir träumen, ist eine höfliche Welt.
Die Menschen, die so etwas dringend brauchen, sind nicht nur die am anderen Ende der Welt – sondern auch die am anderen Bildschirm.

