Der Siegeszug der Moralapostel
Das ideologische Korsett wird an den Universitäten immer enger geschnürt. Das schadet nicht nur dem Forschungsbetrieb, sondern der gesamten Gesellschaft.
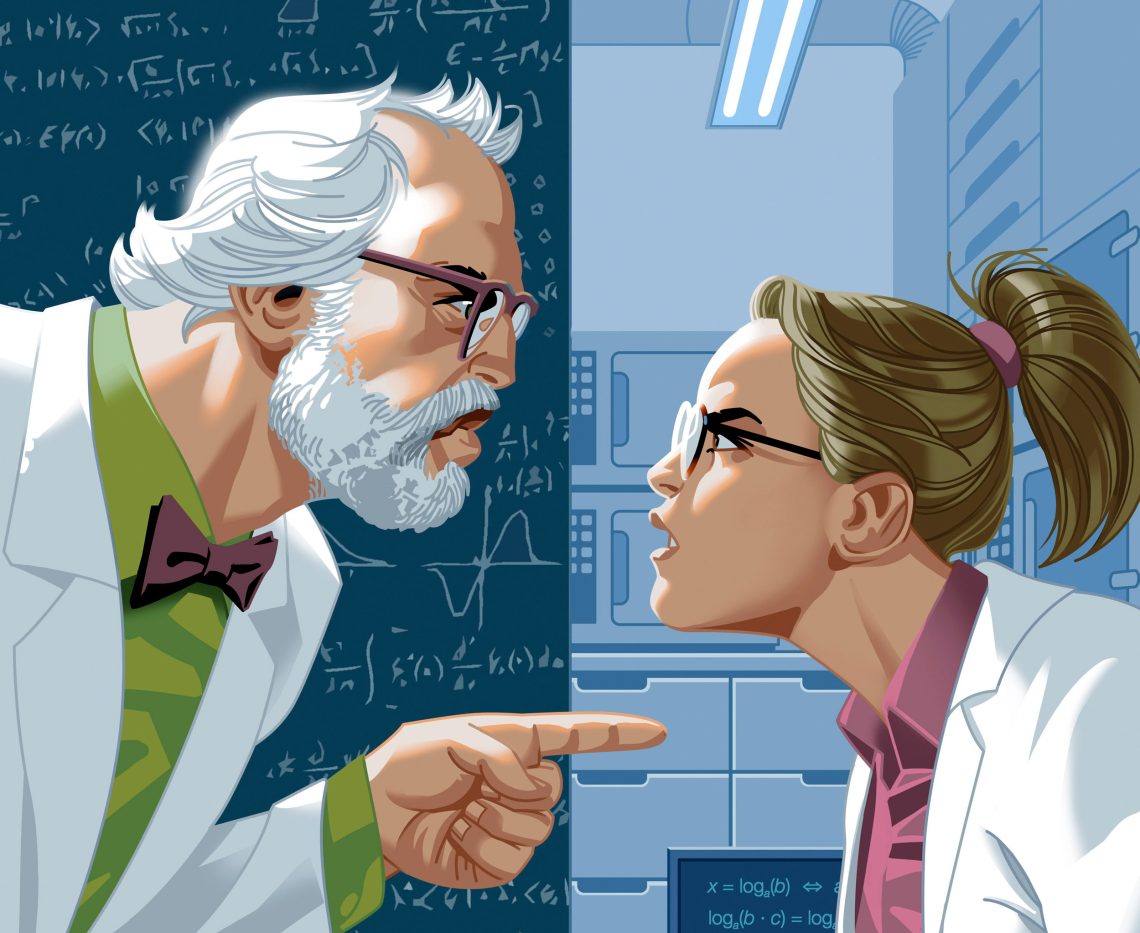
Auf den Punkt gebracht
- Identitätspolitik. Agendawissenschaftler und Studenten nutzen Forschung und Lehre, um ihre gesellschaftspolitischen Ziele voranzubringen.
- Finanzen. Auch in Drittmittelanträgen und Publikationen wird die Forschung unter einen ideologischen Vorbehalt gestellt.
- Wissenschaftsfreiheit. Die Verankerung identitätspolitischer Ziele im Wissenschaftssystem verhindert das ergebnisoffene Streben nach Erkenntnis.
- Weichenstellung. Die Tendenz zu agendakonformer Wissenschaft ist korrigierbar, wenn man den Wissenschaftsbetrieb von Macht- und Moralansprüchen befreit.
Der Gewinn von Erkenntnis war stets Sinn und Zweck jeder Form von Wissenschaft. Gilt das auch heute noch? Man darf es bezweifeln. An den Universitäten ringen Macht und Moral um die Oberhand über die ergebnisoffene Suche nach neuen Blickwinkeln. Das Bestreben, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren, gefährdet die Freiheit der Wissenschaft.
Mehr zur Wissenschaftsfreiheit
Erkenntnis ist die Eigenlogik des Wissenschaftssystems. Je freier sich alle Akteure dieses Systems entfalten können, desto besser kann es seine gesellschaftliche Funktion erfüllen und umso mehr kann es leisten. Wird jedoch die Eigenlogik des Wissenschaftssystems durch von außen hereingetragene Interessen überlagert, wird es zunehmend dysfunktional – und illiberal.
Wissenschaftler als Aktivisten
In den vergangenen zehn Jahren kam die wissenschaftliche Eigenlogik vermehrt unter Druck, weil zwei Fremdlogiken an Einfluss gewonnen haben: Macht und Moral. Sie breiten sich aus, weil ein beständig wachsender Anteil an Wissenschaftlern und Studenten versucht, Forschung und Lehre zu nutzen, um ihre gesellschaftspolitischen Ziele voranzubringen, die sich zumeist aus identitätspolitischen Agenden ableiten.
Da die Umsetzung einer gesellschaftspolitischen Agenda ihr Kernanliegen darstellt, greifen sie zum Erreichen ihres Ziels zur Eigenlogik der Politik, also zur Macht. Und um andere Wissenschaftler davon abzuhalten, ihre ideologisch motivierten Forschungsansätze und -ergebnisse einer kritischen Beleuchtung zu unterziehen, führen sie eine zweite Fremdlogik in das Wissenschaftssystem ein: die Moral.
Mithilfe von moralischer Entwertung und Zuschreibungen, wie ein Rassist, Sexist oder wahlweise homo-, trans- oder islamophob zu sein – um nur die gebräuchlichsten zu nennen –, versuchen diese Aktivisten, die Forschungsergebnisse und Argumente von Andersdenkenden zu delegitimieren. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Delegitimierung ist die Biologin Marie-Luise Vollbrecht, die der Transfeindlichkeit beschuldigt wurde, weil sie an der Humboldt-Universität zu Berlin einen Vortrag zur Zweigeschlechtlichkeit bei Fischen halten wollte.
Moral als Machtinstrument
Insbesondere der Vorwurf der Transphobie ist zuletzt inflationär geworden. Viele Mediziner und Psychologen werden als transphob attackiert, weil sie etwa Pubertätsblockern oder geschlechtsangleichenden Hormontherapien und Operationen bei Jugendlichen kritisch gegenüberstehen und darauf hinweisen, dass diese Therapien psychische und physische Probleme nach sich ziehen können. Moral dient hier offenkundig nicht als Wertmaßstab, sondern wird als Machtinstrument eingesetzt, um Forschung und Diskurs zu verschließen. Allzu oft verfehlt dieses Instrument seine Wirkung nicht: Den allermeisten Menschen ist ihre moralische Reputation nicht gleichgültig; sie wissen oft nicht, wie sie sich gegen solche haltlosen Vorwürfe, die mit großem Furor über sie hereinbrechen, wehren sollen; und sie werden von ihrem Umfeld nicht hinreichend unterstützt, weil dort die Sorge vor einer Kontaktschuld grassiert.
Der Vorwurf der Transphobie ist zuletzt inflationär geworden.
Also meiden Forscher Fragestellungen, die sie zur Zielscheibe moralischer Delegitimierung machen könnten. Dadurch wird die Forschung zu identitätspolitisch aufgeladenen Themen im Lauf der Zeit immer einseitiger und ideologisch normierter. Das ist für sich genommen schon problematisch, weil Wissenschaft vom Prinzip These-Gegenthese lebt. Noch gravierender sind die Folgen, wenn sich Mediziner aus einem Behandlungsfeld zurückziehen und damit letztlich das Wohl von Menschen in die Hand von Ideologen legen.
Ideologische Vorbehalte
Ohne es zu wollen, haben die Hochschulreformen der frühen 2000er-Jahre die von einschlägigen Aktivisten betriebene Politisierung und Moralisierung des Wissenschaftssystems erleichtert: Mit dem kennzahlenbasierten Wettbewerb wurde eine dritte Fremdlogik in das Wissenschaftssystem eingeführt.
Dabei steckte hinter den Reformen eine ganz andere Absicht: Mehr Wettbewerb sollte die Wissenschaftler zu einem größeren und qualitativ besseren Forschungsoutput motivieren, weshalb die Grundfinanzierung der Hochschulen zurückgefahren und stattdessen ein Anreizsystem geschaffen wurde, Drittmittel für Forschungsprojekte einzuwerben und viel zu publizieren. Um festzustellen, wie einzelne Wissenschaftler in diesem Wettbewerb abschneiden, wurden Kennzahlen eingeführt. Die relevantesten sind die Höhe der eingeworbenen Drittmittel und der Hirsch-Index. Letzterer misst die Anzahl von Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften und die Häufigkeit des Verweises auf diese Texte durch andere Autoren.
Jagd nach Zitierungen
Der wissenschaftliche Stellenwert eines Textes hängt also in hohem Maße an seinem Veröffentlichungsort und der Zahl der Zitierungen. In einer perfekten Welt, frei von menschlichen Schwächen, Hierarchien und ideologischer Motivation, könnte so ein Verfahren funktionieren und den Ehrgeiz der Forscher wie gewünscht anstacheln. Die Realität sieht jedoch anders aus – schon allein deshalb, weil es einiges an Charakterstärke erfordert, der Förderung von Forschungsprojekten und der Publikation von Texten zuzustimmen, die die eigene Arbeit infrage stellen oder gar widerlegen.
Wenn dann noch Wissenschaftler an der Begutachtung von Drittmittelanträgen und Publikationen beteiligt sind, die Forschung unter einen ideologischen Vorbehalt stellen, haben manche Projekte und Studien kaum noch eine Chance auf Finanzierung und Veröffentlichung – schlicht und einfach deshalb, weil sie nicht ideologiekonform sind. Hinzu kommt, dass vor allem Doktoranden, Postdoktoranden und andere befristet beschäftigte Wissenschaftler (das sind in Österreich zusammen 80 Prozent) stets darauf achten müssen, ihr Vorankommen beziehungsweise ihren Verbleib im System nicht zu gefährden.
Abhängigkeiten und Hierarchien befördern den Konformismus – und behindern wissenschaftliche Erkenntnisse. Wer soll noch Forschungsfragen stellen, wenn er davon ausgehen muss, dass er damit bei Gutachtern und Besetzungskommissionen Missfallen erregen könnte? Der eigenen Karriere ist es ja viel förderlicher, sich stattdessen Themen zuzuwenden, die bei den entscheidenden Akteuren im System auf Wohlgefallen stoßen.
Identitätspolitisch motivierten Agendawissenschaftlern ist es gelungen, anderen Kollegen zu signalisieren, dass sie mit nicht konformen Forschungsfragen karrieregefährdendes Territorium betreten.
Als Folge davon bringen Nachwuchswissenschaftler sehr viel weniger frischen Wind und Innovation in den Apparat, als das unter anderen Bedingungen der Fall wäre. Das gilt vor allem in Fachrichtungen, die einen höheren Anteil an Agendawissenschaftlern aufweisen – also jenes Typs von Universitätspersonal, der Forschung und Lehre als Instrumente zur Verwirklichung seiner Weltanschauung betrachtet.
Agendawissenschaftler mit Fokus auf Identitätspolitik
Identitätspolitisch motivierten Agendawissenschaftlern ist es gerade in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften gelungen, anderen Kollegen zu signalisieren, dass sie mit nicht konformen Forschungsfragen karrieregefährdendes Territorium betreten. Das ist für sich betrachtet schon ein erstaunlicher Erfolg. Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass sie ihre Agenda zudem auf die Ebene der wissenschaftlichen Infrastruktur „hochladen“ konnten.
Auf diese Weise haben sie es geschafft, ihre Wirkmächtigkeit weit über die eigenen Fachdisziplinen auszudehnen. Da Verlage und Institutionen der Forschungsförderung identitätspolitische Paradigmen übernommen haben, sind alle Wissenschaftler betroffen, die dort publizieren oder Drittmittel einwerben möchten.
Schädliche Forschung
So haben die Herausgeber von Nature, einer der weltweit renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften, im Juni 2022 in einem Leitartikel mit dem Titel „Research must do no harm“ alle Autoren aufgefordert, ihre Forschungsergebnisse daraufhin zu prüfen, ob sie eventuell Interpretationen ermöglichen, die sich für bestimmte Gruppen schädlich auswirken könnten. Exemplarisch genannt wurden Ergebnisse, die dazu führen könnten, dass Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe „stigmatisiert, diskriminiert oder Rassismus, Sexismus oder Homophobie ausgesetzt werden“.
Dass Forschung Menschen keinen Schaden zufügen soll, ist eine Selbstverständlichkeit. Den Herausgebern geht es aber offensichtlich um mehr: Forschung soll keine Interpretation ermöglichen, die ein negatives Licht auf bestimmte Gruppen werfen könnte.
Wie sehr diese Forderung von identitätspolitischen Agenden geprägt ist, wird durch den Fokus auf Gruppen sowie die Begriffe Rassismus, Sexismus und Homophobie verdeutlicht. Identitätspolitik zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie Menschen nicht als Individuen, sondern als Träger bestimmter Merkmale betrachtet und behandelt, wobei sie ihr Hauptaugenmerk auf die Merkmale Ethnie, Geschlecht, Genderidentität und sexuelle Orientierung richtet.
Zahlen & Fakten
Rebellen der Forschung

Katalin Karikó
2012, kurz vor Weihnachten, wird die 57-jäh rige Katalin Karikó von der University of Pennsylvania („Penn“) vor die Tür gesetzt. Zehn Jahre nach ihrem letzten Arbeitstag erhält sie den Nobelpreis. Karikó, 1955 im ungarischen Szolnok geboren, promoviert 1982 an der Universität Szeged in Biochemie. Sie ist besessen von der mRNA (Messenger-Ribonukleinsäure), jenem Stoff, der unseren genetischen Code in Proteine übersetzt. Für besonders klug hält sie sich selbst nicht, wie sie später erzählt, aber was ihr an natürlichen Fähigkeiten fehle, könne sie durch Anstrengung wettmachen. Als ihr Labor 1985 nicht mehr finanziert wird, wandert Karikó mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter in die USA aus. Ihr Startkapital von 900 Pfund aus dem Verkauf ihres Autos auf dem Schwarzmarkt schmuggelt sie im Teddybär ihrer Tochter aus dem Land. 1989 kommt sie an die Penn, wo sie 1998 den Immunologen Drew Weissman trifft. Beide forschen fortan gemeinsam an der Entwicklung von Medikamenten auf mRNA-Basis und gründen ein Unternehmen, vorerst ohne konkreten Erfolg. Ihr Patent auf die Technologie verkaufen sie an die Universität. Das Interesse der Penn an Karikós Forschung ist enden wollend. Zur wissenschaftlichen Angestellten degradiert, arbeitet Karikó jahrelang in einem winzigen Labor. 2012 wird sie entlassen, weil sie nicht genug Drittmittel eingeworben hat: zu wenig Dollar pro Quadratmeter. So geht sie 2013 als Senior Vice President zu BioNTech. Der Rest ist Geschichte: Als Covid-19 ausbricht, entwickeln BioNTech und Karikó mit Unterstützung von Pfizer einen Impfstoff. Jetzt kehrt sie an die Penn zurück, wo sie mit Beifallsstürmen begrüßt wird. Das Patent gehört übrigens immer noch der Universität, BioNTech und Moderna haben nur Sublizenzen. Am 2. Oktober 2023 erhalten Katalin Karikó und Drew Weissman den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.
Indem die Herausgeber von Nature Interpretationsmöglichkeiten von Forschungsergebnissen zum Maßstab für Schädigungen erheben, sind potenziell alle Themen betroffen, die sich auf eine der Identitätsgruppen beziehen. Man denke zum Beispiel an Studien, die aufzeigen, dass Flüchtlinge deutlich häufiger und länger Transferleistungen beziehen als Erwerbsmigranten oder Menschen ohne Migrationsbiografie. Oder an Studien, die empirisch belegen, dass Frauen sich stärker für soziale und Männer sich für technische Berufe interessieren.
Dogmen gegen Geld
Durch die identitätspolitische Brille gelesen, könnten solche Untersuchungen als nachteilig für das Image von Flüchtlingen und daher als den Rassismus befördernd interpretiert werden, beziehungsweise in Bezug auf Frauen und Männer als klassische Rollenbilder fortschreibend und somit als Sexismus begünstigend. Neben einigen Wissenschaftsmedien haben auch wichtige Drittmittelgeber wie etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) identitätspolitische Dogmen in ihre Entscheidungen über Fördermittel integriert.
In den 2022 veröffentlichten Forschungsorientierten Gleichstellungs- und Diversitätsstandards gibt die DFG bekannt, dass künftig bei der Vergabe von Forschungsgeldern berücksichtigt werde, inwieweit die antragstellenden Hochschulen diese Standards umgesetzt hätten. Konkret macht die DFG die Drittmittelvergabe davon abhängig, dass Hochschulen Gleichstellung und Diversität „durchgängig und sichtbar auf allen Ebenen“ verfolgen, einschließlich „bei der Personalauswahl und bei Entscheidungen über Ressourcen“.
Wissenschaftler, die an Fördergeldern interessiert sind, werden von Forschungsfragen Abstand nehmen, die sich kritisch mit der Identitätspolitik auseinandersetzen.
Als Diversitätsmerkmale, die bei der Entscheidung über finanzielle Förderungen eine wichtige Rolle spielen, werden außer dem Geschlecht und der sexuellen Identität folgende Kriterien genannt: „ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung oder chronische/langwierige Erkrankung sowie soziale Herkunft und sexuelle Orientierung“. Zudem soll „das Zusammenkommen mehrerer Unterschiedsdimensionen in einer Person (‚Intersektionalität‘) berücksichtigt werden“, heißt es in den Richtlinien der Forschungsgemeinschaft. Die DFG geht damit klar über ihre eigentliche Funktion im Wissenschaftssystem hinaus – die Förderung von Forschungsvorhaben – und übernimmt eine gesellschaftspolitische Rolle.
Normierte Wissenschaft
Auf diese Art weicht sie ihre politische Neutralität zugunsten einer spezifischen politischen Richtung auf: im konkreten Fall der Identitätspolitik, deren Hauptziel die Repräsentation aller Identitätsgruppen entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil in sämtlichen Institutionen ist. So politisiert sich die DFG selbst und versucht darüber hinaus, Hochschulen und Wissenschaftler zur Übernahme identitätspolitischer Ziele zu motivieren. Zwar bleibt es die Entscheidung jeder Hochschule und jedes einzelnen Wissenschaftlers, ob und inwieweit sie Identitätsgruppen fördern und sichtbar machen möchten. Aber wenn alle Beteiligten wissen, dass sie sich mit einer Weigerung nur selbst das Leben schwermachen, werden sich die meisten an diese Spielregeln halten.
Allein die Kenntnis der möglichen Konsequenzen sorgt für normiertes Verhalten. Es ist naheliegend, dass Wissenschaftler, die an DFG-Geldern interessiert sind, von Forschungsfragen Abstand nehmen, die sich kritisch mit der Identitätspolitik auseinandersetzen. Es ist erwartbar, dass an den Hochschulen der Druck auf „abweichend“ forschende Wissenschaftler wächst, weil Kollegen und Leitungen befürchten, dass solche Studien ein „schlechtes“ Licht auf die Institution werfen und sich folglich negativ im Wettbewerb um Forschungsgelder auswirken.
Die Verankerung identitätspolitischer Ziele im Wissenschaftssystem bedeutet letztlich die Aushöhlung der zentralen Eigenlogik des Systems: dem ergebnisoffenen Streben nach Erkenntnis, das nur in einem intellektuell freiheitlichen Klima funktionieren kann.
Conclusio
Das Zusammenwirken von Macht, Moral und kennzahlenbasiertem Wettbewerb hat erhebliche Folgen für die intellektuelle Freiheit von Wissenschaftlern, für das Wissenschaftssystem und schlussendlich für die Gesamtgesellschaft. Wenn die Anreiz- und Sanktionsmechanismen einen intellektuell normierten Forschungskorridor hervorbringen, wird zu manchen Fragen nicht mehr geforscht, und mögliche Erkenntnisse stehen der Gesellschaft nicht zur Verfügung. Die Weichen sind zwar in Richtung agendakonformer Wissenschaft gestellt, aber alle diese Weichenstellungen sind korrigierbar. Die Akteure im Forschungsbetrieb müssen sich nur darauf besinnen, dass Wissenschaft am besten nach ihrer Eigenlogik funktioniert, und sich dafür engagieren, das Wissenschaftssystem von den Fremdlogiken zu befreien.


