Sternstunden der Grammatik?
Die Befürworter des Genderns behaupten, Sprache erschaffe Wirklichkeit. Diese Vorstellung ist absurd: Ein verordneter Sprachwandel wird zur Gleichstellung der Geschlechter nichts beitragen.
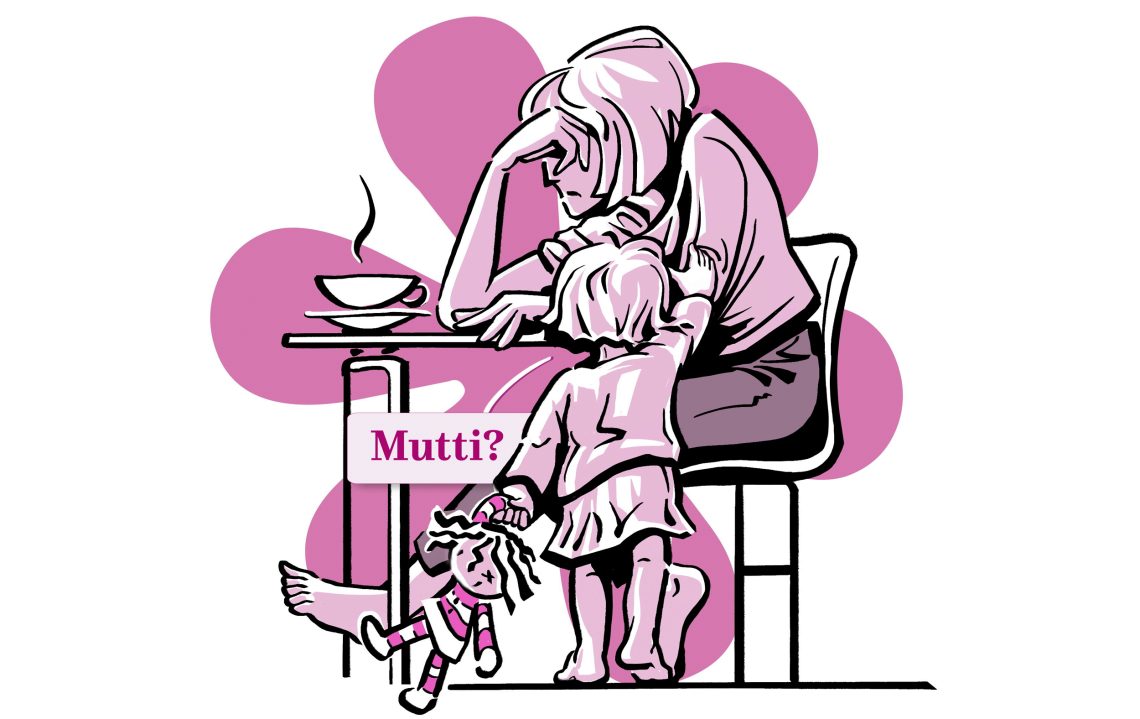
Auf den Punkt gebracht
- Neutral. Das generische Maskulinum von Nomen und Pronomen macht keine Aussage über das Geschlecht der Bezeichneten.
- Geschlecht. Die Kritik daran basiert auf der fehlerhaften Annahme, Genus (grammatische Kategorie) sei mit dem Sexus (biologische Kategorie) gleichzusetzen.
- Denken. Die Bedeutung eines Ausdrucks wird nicht aus Assoziationen abgeleitet, sondern durch den jeweiligen Kontext bestimmt.
- Wirklichkeit. Der Zusammenhang von Sprache und Denken wird massiv überschätzt, das bezeugt ein Blick aufs Ungarische oder Türkische.
Gibt es in Bezug auf sogenannte gendergerechte Sprache überhaupt noch etwas Neues zu berichten? Haben wir uns an diese hier und da aufpoppenden Parallelformen nicht schon längst gewöhnt? Und haben wir uns nicht auch daran gewöhnt, dass keiner so spricht? Warum also all die Aufregung? Und wer regt sich überhaupt noch auf? Sind es wirklich die Gendergegner, die ihr generisches Maskulinum einfach nicht loslassen können, oder vielleicht nicht doch eher die Befürworter, die ihre Felle davonschwimmen sehen und die Debatte immer wieder von neuem entfachen, um ihre Argumente aufs Tapet zu bringen?
Worüber sprechen wir?
Beginnen wir mit einer Begriffsklärung: Mit dem generischen Maskulinum ist jene Lesart maskuliner Nomen und Pronomen gemeint, mit der keine Aussage über das Geschlecht der Bezeichneten gemacht wird. Beispiele für die generische Verwendung von Nomen finden sich in Sätzen wie Der Steuerzahler wird künftig entlastet oder Politiker sind auch nur Menschen. Auch Pronomen wie wer, man, niemand oder jemand sind obligatorisch maskulin, was man daran sieht, dass ein etwaiges Bezugswort ebenfalls maskulin sein muss: Jemand hat seine (nicht: ihre) Tasche vergessen.
Mehr zum Thema Gendern
Auch Frauen sind jemand
Auf Personen jeglichen Geschlechts anwendbar bleiben sie trotz – oder besser: aufgrund – ihrer maskulinen Genusmerkmale. Folglich kann der oben erwähnte vergessliche Jemand eine Frau oder eine nicht-binäre Person sein. Und auch aus dem Steuerzahler-Satz wird wohl niemand ernsthaft folgern, dass nur männliche Steuerzahler entlastet werden, alle anderen aber nicht. Feminina hingegen besitzen keine geschlechtsabstrahierende Lesart. Das zeigt sich etwa daran, dass es weibliche Patienten, aber keine männlichen Patientinnen gibt.
Die „generisch“ genannte Verwendung maskuliner Ausdrücke wird schon seit den frühen 1980er-Jahren durch die feministische Linguistik kritisiert. Diese Kritik basiert – damals wie heute – auf der fehlerhaften Annahme, maskulines Genus (eine grammatische Kategorie) sei mit männlichem Sexus (einer biologischen Kategorie) gleichzusetzen.
Zahlen & Fakten
In den 1980er-Jahren noch ein Nischenthema, ist um das Jahr 2018 herum, nach Gesetzesnovellen in Bezug auf das Personenstandsrecht (Stichwort: „drittes Geschlecht“ bzw. Geschlechtseintrag „divers“), die Frage nach einer zur neuen Rechtssituation passenden sprachlichen Umgestaltung in den Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Gendern, also das Einfügen von Sonderzeichen wie Stern [*], Unterstrich [_] oder Doppelpunkt [:] innerhalb eines Wortes, wurde populär, weil es die sprachliche Inklusion aller Geschlechter symbolisierte. Zugleich behaupteten die Befürworter der neu entstandenen Formen, das generische Maskulinum würde Frauen und nicht-binäre Personen ausschließen oder „nur mitmeinen“.
Fühlst du, was ich denke?
Vermeintliche Evidenz für das Fehlen einer generischen Lesart maskuliner Ausdrücke liefern sogenannte Assoziationsstudien. Sie überprüfen, woran Testpersonen denken, wenn ihnen bestimmte Ausdrücke vorgesetzt werden. Diese Studien werden von Genderbefürwortern nach wie vor als „Königsevidenz“ hochgehalten.
Der Zusammenhang von Sprache und Denken wird massiv überschätzt.
Bei diesem An-etwas-Denken wird jedoch vergessen, dass die Bedeutung eines Ausdrucks nicht aus den Assoziationen einer Mehrheit abgeleitet, sondern durch den sprachlichen oder außersprachlichen Kontext bestimmt wird: So kann das Wort Lehrer männliche Personen bezeichnen („Hans und Otto sind Lehrer“) oder geschlechtsabstrahierend verwendet werden („Als Lehrer hat man viel frei“) und sich auf eine Einzahl oder Mehrzahl beziehen. Wissenschaftlich problematisch sind diese Studien auch, weil Assoziationen subjektiv sind: Nehmen wir das Wort Klee – während ich an das Wappen eines Sportvereins denke, denkt eine andere Person an das neue Jahr. Beide Assoziationen sind für die Bedeutung des Wortes Klee jedoch irrelevant, weil Klee eine Pflanzengattung bezeichnet. Hinzu kommt, dass das assoziative Bedeutungskonzept bei abstrakteren Ausdrücken wie und, sogleich, oder versagt: An was nur könnte man hier – übereinstimmend – denken?
Sprache und Wirklichkeit
Gendern, so die Logik vieler, die es praktizieren oder gutheißen, ist wichtig, weil Sprache unsere Wirklichkeit formt. Diese unbewiesene Annahme (auch bekannt als Sapir-Whorf-Hypothese) wird jedoch nicht als Vermutung formuliert, sondern zur Tatsache erklärt. Dass schönere Bilder im Kopf eine schönere Welt erschaffen können, ist ein netter Gedanke. Seine Einfachheit verfängt. Aber Sprache schafft keine Realität – die Sapir-Whorf-Hypothese gilt weitgehend als widerlegt. Wäre sie es nicht, könnte man sich damit ganz fein herausreden. Die Benachteiligung von Frauen und nicht-binären Personen wäre allein eine Folge der Sprache und des Sprechens und nicht der gesellschaftlich-politischen Umstände – frei nach Wilhelm Busch: „Der Esel ist ein dummes Tier, der Elefant kann nichts dafür.“
Dass der Zusammenhang von Sprache und Denken massiv überschätzt wird, bezeugt allein der Blick nach Ungarn oder in die Türkei, zwei Länder mit genuslosen Sprachen. Hätte Sprache die von Genderbefürwortern postulierte Wirkung, „Wirklichkeit zu erschaffen“, wäre die Gleichstellung der Geschlechter dort nicht nur längst hergestellt, sondern würde über den Spracherwerb automatisch eingesogen – eine absurde Vorstellung!
Wo bleibt der Sprachwandel?
Es fragt sich, warum das Thema überhaupt so kontrovers diskutiert wird, wenn Umfragen zufolge die Mehrheit gegen eine Verwendung sogenannter gendergerechter Sprache ist. Eigentlich sollte die Sache doch klar sein – zumal in einem demokratischen „Bottom-up“-System. Auch der grammatische Wandel funktioniert so, von unten nach oben.
Selbst in urbanen Gegenden, die vorwiegend von akademischen Eliten bewohnt werden, bleiben gegenderte Formen ungehört.
Dass Gendern Teil eines natürlichen Sprachwandels ist, hört man zwar immer wieder, beruht aber einzig und allein auf der Hoffnung ihrer Befürworter, dass die hierarchische Top-down-Methode, mit der es von Institutionen und Behörden eingeführt wurde, irgendwann eine Nivellierung „von unten“ erfährt. Doch wie realistisch ist diese Hoffnung? Wäre das Gendern in der Sprachwirklichkeit angekommen, müssten einem ja – zumindest ab und zu – Menschen begegnen, die es praktizieren. Doch selbst in urbanen Gegenden, die vorwiegend von akademischen Eliten bewohnt werden, bleiben gegenderte Formen ungehört. So planmäßig, wie sie eingeführt wurden, so planmäßig bleibt auch ihre Verwendung: schriftlich, vorformuliert und unspontan – typisch für genormte Anschreiben, Unternehmenskommunikation und vorgefertigte Reden.
Wann man es trotzdem vernimmt? Ab und an im Uni-Seminar oder wenn man Leute, die Gendern wichtig finden, darauf anspricht. Doch schon ein kleiner Moment der Unachtsamkeit lässt sie wieder zurückfallen in alte Gewohnheiten und Bequemlichkeiten, was ja nur natürlich und der Sprachökonomie geschuldet ist – selten jedoch einem bösen Willen, bestimmte Personengruppen ausschließen zu wollen. Es ist eben wie im Alltag: Man nimmt eine Abkürzung, nicht, weil man unbedingt einen Rasen zertrampeln oder dem Grundstücksbesitzer eins auswischen möchte, sondern weil man auf kürzestem Weg von A nach B kommen will.
Gegen jede Sprachökonomie
Doch wenn Sprachökonomie so wichtig ist – warum wird überhaupt gegendert? Auf den Webseiten hipper Onlineshops, aber auch bei Behörden und Universitäten finden sich kaum noch generische Maskulina, stattdessen walten dort neben Partizipformen (Dachdeckende und Mauernde lassen grüßen) Genderstern und Co. Und man fragt sich, welches Prinzip, das die Sprachökonomie außer Kraft setzt, da aktiv ist. Die kurze Antwort: adressatenbezogene Höflichkeit. Ihretwegen scheut man keine Umstände.
Und so sind es eben nicht die lieben Kunden, sondern die lieben Kundinnen und Kunden oder auch die lieben Kund*innen, als welche man angesprochen bzw. angeschrieben wird. Solch eine Sprachverwendung mag im Ansatz gut gemeint sein, verkommt aber immer häufiger zum woken Awareness-Marker – und damit zur standardisierten Hülle und leeren Phrase eines selbstbezogenen (PR-)Egos. Nicht nur einzelne Sprecher, sondern vor allem Unternehmen und Institutionen nutzen gegenderte Sprache, um Sensibilität, Aufgeklärtheit und Inklusion zu suggerieren. Ob diese in Sprachsymbolik verpackte Selbstpositionierung in der Realität eingelöst wird (z. B. durch gleiche Löhne für m/w/d) oder nur ein oberflächliches, kapitalgenerierendes „Pink-Washing“ darstellt (in Analogie zum Green-Washing), steht auf einem anderen Blatt.
Bastelrunde Grammatik
Ebenfalls auf einem anderen Blatt steht die Frage, inwieweit die Sternchen-Formen in die Grammatik des Deutschen integrierbar sind. Bei Anreden wie Liebe Teilnehmer*innen tritt das Problem nicht auf, aber schaut man sich im weiteren Formenbestand um, sieht man, dass es sich nicht um problematische „Einzelfälle“ handelt, sondern dass Gendern nur in Einzelfällen unproblematisch ist: Allen voran seien kumulative Artikelformen wie bei der*die Teilnehmer*in erwähnt. Aber auch viele Nomen können aufgrund inkompatibler Endungen nicht gebildet werden. Man denke z. B. an die Unterschrift des*der Teilnehmers*in. Was passiert mit dem „s“ des Teilnehmers, das die Teilnehmerin nicht will? Soll es Formen wie Dozenten*in geben (in Sätzen wie Ich unterstütze den*die Dozenten*in) oder jedem*r (in Sätzen wie Ich helfe jedem*r)?
So wie es aussieht, steht die Zukunft doch nicht in den Sternen.
Manch eine*r war womöglich enttäuscht, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung in seiner letzten Sitzung keine Freigabe für das Gendern erteilt hat. Wie denn auch? Er hätte es nur tun können, wenn er gleichzeitig eine Empfehlung für den Umgang mit entsprechenden Problemfällen gegeben hätte. Und die hätte er als Genderspracharchitekt am Reißbrett entwerfen müssen.
Auf den vielbeschworenen „Problemlöser“ Sprachwandel, der seine unsichtbare Hand zum Wohle gegenderter Formen walten lässt, müssen wir wohl noch warten: So wie es aussieht, steht die Zukunft doch nicht in den Sternen.
Conclusio
Die Kritik am generischen Maskulinum durch die feministische Linguistik beruht auf zwei fehlerhaften Annahmen. Zum einen, dass die grammatische Kategorie (Genus) mit der biologischen (Sexus) gleichzusetzen sei, und zum anderen, dass unsere Sprache die Wirklichkeit formen könne. Sprache wandelt sich auf natürliche Weise von unten nach oben. Dies ist bei Gendersprache nicht der Fall, sie spricht im Alltag kaum jemand. Die Sprachform ist bürokratisch, floskelhaft und umständlich. Behörden und Unternehmen wollen durch korrektes Gendern Sensibilität, Aufgeklärtheit und Inklusion signalisieren. Ob dieses Versprechen auch eingelöst wird, ist fraglich. Häufig verkommt diese Sprachverwendung zum woken Awareness-Marker und wird dadurch zur leeren PR-Phrase. Die Zukunft gehört dem Genderstern wohl nicht.


